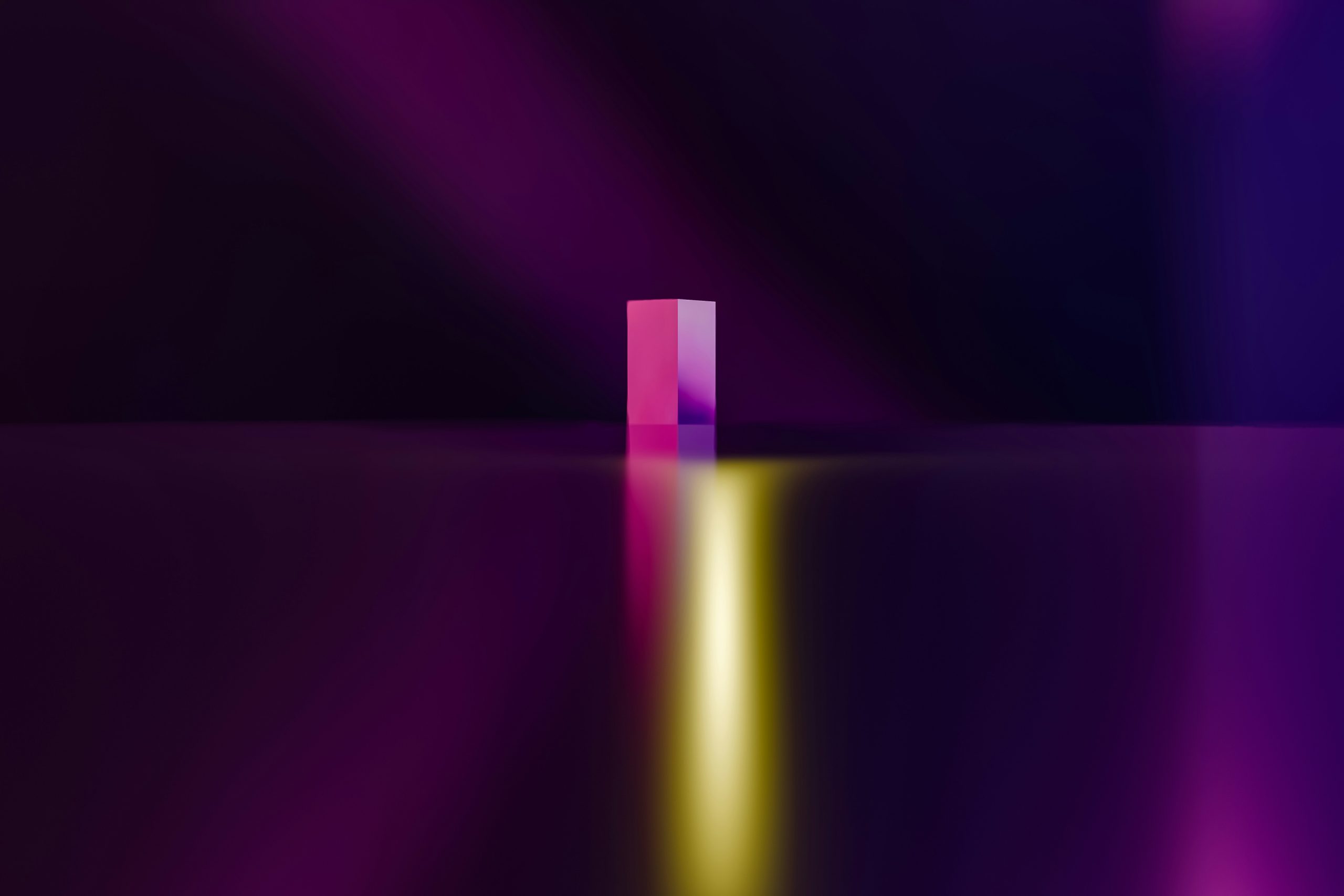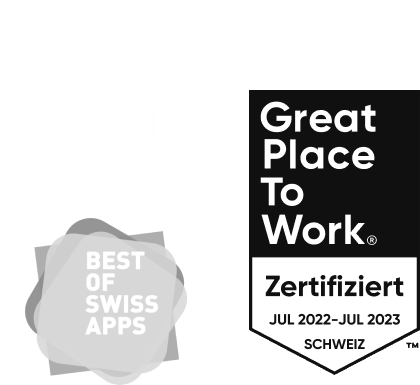Inhaltsverzeichnis
- Gesetz trifft also Zukunft: Warum KI Barrierefreiheit radikal verändern könnte
- KI ist hier ein reines Werkzeug – kein Ersatz für Verantwortung
- Die Gesetze haben sich zurecht verschärft
- Handlungsbedarf für Barrierefreiheit: Eine lange überfällige Priorität
- KI als Partner: Warum menschliches Handeln entscheidend bleibt
Seit dem 28. Juni 2025 verpflichtet das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) digitale Angebote zur Einhaltung von Barrierefreiheitsstandards. Webseiten, mobile Anwendungen, E-Commerce-Plattformen, Self-Service-Terminals und digitale Dokumente müssen so gestaltet sein, dass sie ebenfalls für Menschen mit Behinderungen uneingeschränkt nutzbar sind.
Grundsätzlich gibt es jedoch das BehiG bereits seit 2004 und stützt sich auf die Schweizer Bundesverfassung (Art. 8 BV). Es verfolgt seit jeher das Ziel, Benachteiligungen abzubauen und Teilhabe zu fördern. Konkretisiert wird es durch die Behindertengleichstellungsverordnung (BehiV), die für digitale Angebote Standards wie WCAG 2.1 AA oder den Schweizer eCH-0059-Standard vorschreibt. Mit der Teilrevision von 2024 wurde zudem das Prinzip der „angemessenen Vorkehrungen“ eingeführt, wodurch auch private Anbieter*innen stärker in die Pflicht genommen werden. So kam es nach 20 Jahren zur Verschärfung dieser Grundlage, da nach wie vor viele Anbieter*innen nicht zugänglich sind.
Wer diesen Wandel nun nur als gesetzliche Auflage betrachtet, verpasst eine spannende und innovative Chance oder Möglichkeit – denn: Künstliche Intelligenz kann dabei helfen, digitale Angebote nicht nur rechtskonform, sondern wirklich inklusiv zu gestalten. Sind Sie unsicher, ob Ihre Services die aktuellen Standards erfüllen? Finden Sie es jetzt heraus!
Wichtig im Umgang mit dieser Thematik ist, dass ein barrierefreies digitales Angebot nicht durch einmalige Anpassung, sondern durch kontinuierliche Überprüfung, Verbesserung und echte Nutzerorientierung entsteht. Daher kann KI hier wertvolle Unterstützung bieten, etwa durch:
- Automatisiertes Accessibility-Monitoring: KI-gestützte Tools können Websites und Apps regelmässig scannen und auf Barrierefreiheit prüfen – etwa bei Kontrasten, Alternativtexten oder Tastatur-Navigation.
- Semantische Analyse von Inhalten: KI kann Texte auf Lesbarkeit, Struktur und Verständlichkeit prüfen – gerade für Menschen mit kognitiven Einschränkungen ein wichtiger Aspekt.
- Bildbeschreibung und automatische Alternativtexte: KI-Modelle sind inzwischen in der Lage, Bilder kontextsensitiv zu beschreiben – Gerade für Screenreader-Nutzer*innen ein wichtiger Aspekt.
- Echtzeit-Übersetzung und Gebärdensprache: Mit KI lassen sich Inhalte automatisch in einfache Sprache oder sogar visuelle Übersetzungen (z. B. Gebärdensprach-Avatare) übertragen.
- Personalisierung der Darstellung: KI kann helfen, Inhalte individuell anpassbar zu machen – z. B. grössere Schrift, vereinfachte Navigation oder Sprachsteuerung.
So mächtig diese Technologien natürlich sind: Barrierefreiheit darf nun nicht allein der KI überlassen werden. Sie erfordert klare interne Standards, menschliche Kontrolle und vor allem – den Einbezug von Betroffenen. Ausserdem ist Folgendes ebenfalls zu beachten:
- Inklusive Datengrundlagen: KI-Systeme können nur so gut sein wie die Daten, auf denen sie trainiert wurden. Deshalb braucht es Diversität unter Berücksichtigung der Ethik und der Sensibilität hinsichtlich der Datenbasis.
- Transparente Entscheidungslogik: Wer sich auf KI verlässt, muss erklären können, wie sie arbeitet – besonders, wenn es um Zugänglichkeit geht.
- Feedback statt Annahme: Betroffene Nutzer*innen müssen eingebunden werden – durch Usability-Tests, Feedbackschleifen und Co-Creation.
Denn nach wie vor weisen gemäss der seit 1999 bekannten US-Organisation «Web Accessibility in Mind» 94.8% der Seiten im Web Fehler rund um die Zugänglichkeit auf. Der häufigste Fehler sind dabei mangelhafte Kontrastierung und nicht vorhandene Alt-Texte.
Das BehiG macht in der Schweiz daher klare Vorgaben: Wenn Angebote für Betroffene nicht zugänglich sind, können sie Rechtsansprüche stellen. Dies kann für Dienstleister*innen und Anbieter*innen schnell teuer werden und unter anderem zu Reputationsschäden führen.
BehiG-konform? Finden Sie es in 2 Minuten heraus
Sie sind sich unsicher, ob Ihre digitalen Angebote den Standards entsprechen? Um Ihnen eine erste Einschätzung zu ermöglichen und Klarheit zu schaffen, haben wir eine kostenlose BehiG-Konformitätsprüfung entwickelt. Mit unserem schnellen Online-Check finden Sie heraus, wo Ihre Website bereits gut aufgestellt ist und wo es konkreten Handlungsbedarf gibt.
Unternehmen, Agenturen und Softwareanbieter stehen längst in der Pflicht:
Wer digitale Services entwickelt oder betreibt, muss Barrierefreiheit strategisch verankern – und kann KI gezielt dafür nutzen. Das bedeutet konkret:
- Nicht warten, sondern messen: Frühzeitiges Monitoring mit KI-gestützten Tools schafft Klarheit über Handlungsbedarf.
- Barrierefreiheit in die Prozesse integrieren: Accessibility darf kein Add-on sein, sondern muss Teil der Strategie und des Qualitätsmanagements sein.
- KI bewusst einsetzen: Nicht jedes Tool ist geeignet. Wer verantwortungsvoll mit KI arbeitet, prüft, erklärt – und testet mit echten Menschen.
Barrierefreiheit ist kein „Nice to have“ – sie ist ein Menschenrecht, eine gesetzliche Pflicht und inzwischen auch ein Wettbewerbsfaktor. KI bietet nun die Chance, die digitale Welt gerechter und zugänglicher zu gestalten. Aber das gelingt nur, wenn wir sie bewusst, reflektiert und menschenzentriert einsetzen.
Denn echte Inklusion entsteht dort, wo Technologie nicht ersetzt, sondern unterstützt – und wo wir Vielfalt nicht nur anerkennen, sondern einbeziehen und so gestalten.